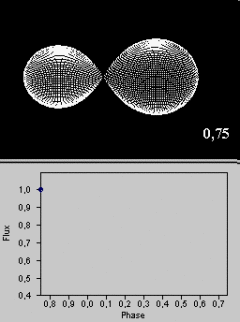Was kann ich beobachten?
Deep Sky
Unter Deep-Sky verstehten Astronomen, alle Objekte im Universum, die sich außerhalb unseres Sonnensystems befinden. Dazu gehören alle Sterne, Doppelsterne, Sternhaufen, Kugelsternhaufen und Nebel. Diese befinden sich noch in unserer Milchstraße (Galaxie). Aus diesem Grund sind sie nicht weiter
als ca. 100.000 Lichtjahre von uns entfernt.
Ein Lichtjahr ist die Strecke, die ein Lichtstrahl innerhalb eines Jahres zurücklegt. Dies entspricht rund 9.460.800.000.000 Kilometer oder 9,46 Billionen Kilometer.
Bei den anderen Deep-Sky Objekten handelt es sich um ferne, eigenständige Galaxien. Ihre Entfernung zu uns beträgt, von ca. 2,3 Millionen Lichtjahren (Andromeda- Galaxie), bis hin zu ca. 13,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung
(Galaxie MACS0647-JD).
Sterne
Sterne sind eigenständig leuchtende Gasbälle, so wie unsere Sonne. Sie können auch in den größten Teleskopen der Welt, nur als Lichtpunkte wahrgenommen werden. Ihre Entfernung ist einfach zu groß, um irgend-
welche Oberflächendetails erkennen zu können. Sie erscheinen uns im Teleskop zwar heller als mit bloßem Auge, bleiben aber immer nur Lichtpunkte. Einzig zu erkennen, ist die Farbe des Sterns. Diese ist abhängig von seiner Temperatur. Sie reicht von heißen, blauen Sternen (O- Sterne mit über 30.000 K Oberflächentemperatur) bis hin zu rotorange-farbenen Sterne (M-Sterne 2.000 - 3.300 K Oberflächentemperatur.
Man unterscheidet O / B / A / F / G / K / M- Sterne.
Zwei schöne Merksprüche:
Offenbar Benutzen Astronomen Furchtbar Gerne Komische Merksätze
oder
Oh Be A Fine Girl Kiss Me.
Doppelstern- oder Mehrfachsterne
Veränderliche Sterne
Veränderliche sind Sterne, die ihre Helligkeit in Zeiträumen von Tagen bis wenigen Jahren ändern. Auch hier wird wieder in zwei Klassen getrennt:
Die Bedeckungsveränderlichen (siehe Abblidung) und die Pulsierende Veränderlichen:
Bei den Bedeckungsveränderlichen handelt es sich um zwei Sterne, die sich gegenseitig durch ihre Rotation um einen gemeinsamen Schwerpunkt bedecken. Diese Bedeckungen finden in periodischen Abständen statt. Bekanntester Vertreter ist Algol (beta Persei).
Pulsierende Veränderliche sind Sterne, die sich dem Ende ihres Daseins nähern. Durch physische Prozesse im Kern, blähen sie sich auf um nach gewisser Zeit wieder zu schrumpfen. Damit sind auch die Helligkeitsschwankungen zu erklären. Bekanntester Vertreter ist Mira (omikron Ceti). Die Helligkeit wächst in einer Periode von ca. 311 Tagen von mag 9 auf mag 2, um dann wieder zu verblassen.
Mehr als 60% aller Sterne in unserer Milch-
straße sind Doppel- oder Mehrachsterne. Hier muss man unterscheiden:
Optische Doppelsterne: Diese stehen von uns aus gesehen in der gleichen Richtung, sind aber viele Lichtjahre voneinander getrennt. Sie beeinflussen sich nicht gegenseitig. Bekannt sind alpha und beta Centauri (Entfernung 4,3 und 500 Lichtjahre).
Physische Doppelsterne: Zwei Sterne, die räumlich miteinander verbunden sind und sich um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen.
Eine besondere Herausforderung ist es, ausgewählte Doppelsterne mit seinem Fernglas bzw. Teleskop zu trennen, so dass diese dann auch als Einzelsterne gesehen werden. Für den Erfolg ist außer einer guten Optik, vor allem ein gutes Seeing (geringe Luftunruhe) entscheidend.
Bekannte Doppel- oder Mehrfachsterne sind z.B.
Albireo im Schwan (beta Cygni):
Der eine scheint orange-rot während der andere weiß-bläulich leuchtet. Ein schöner Farbkontrast.
Alkor / Mizar im Großen Bär (zeta & 80 Ursa Major):
Beide werden auch "Augenprüfer" genannt. Mit guten Augen, sollte Alkor oder auch das "Reiterlein" erkannt werden. Um den helleren Mizar zu trennen, reicht bereits ein Fernglas oder ein kleines Teleskop, ab 50mm Öffnung.
Epsilon Lyra in der Leier:
Hier handelt es sich sogar um ein 4-fach System. In einer dunklen Nacht und sehr guten Augen, kann man bereits zwei Sterne erkennen. Mit einem Linsenteleskop (Refraktor) ab 70mm und einem Spiegelteleskop (Reflektor) ab 100mm Öffnung, kann jeder dieser zwei Sterne, nochmals in zwei Einzelsterne aufgelöst werden.
Offener Sternhaufen (Open Custer, OC)
Als offene Sternhaufen werden Sternansammlungen von 20 bis zu einigen hundert Sternen be-
zeichnet. Diese sind aus einer Riesengaswolke entstanden und meist nicht älter als ein paar hundert Millionen Jahre. Ihre Struktur ist unregelmäßig. Oft stören sich die Sterne gegen-
seitig in ihren Bahnen und dadurch verlieren die Sternhaufen auch einige Mitglieder.
Bekannte Vertreter:
M 45 oder auch Plejaden (Siebengestirn) im Stier
M 44 oder Praeseppe im Krebs
NGC 869 & NGC 884, auch als h & chi Pereus bekannt, ein schöner Doppelsternhaufen (siehe Aufnahme).
Kugelsternhaufen (Globular Cluster, GC)
Sterne in einem Kugelsternhaufen beein-
flussen sich gegenseitig durch ihre Gravitation. Deshalb haben diese Haufen auch ein kugelförmiges Aussehen. Es handelt sich hierbei um Ansammlungen vieler alter Sterne, welche sich im Rand-
bezirk ihrer Galaxie, dem Halo, befinden. Sie stehen auch gravitativ mit ihrer Galaxie in Verbindung.
Bekannte Vertreter:
M 13 Kugelsternhaufen im Herkules (siehe Aufnahme)
M 15 im Pegasus
Galaktische Nebel (GN)
Auch hier wird wieder zwischen Reflexionsnebeln (RN), Emissionsnebeln (EN) und Dunkelnebeln (DN) unterschieden.
Unter Refelxionsnebel (RN) versteht man Wolken aus interstellarem Staub, der das Licht benachbarter Sterne reflektiert. Sie leuchten also nicht selber, sondern streuen nur das Licht der Sterne in ihrer Umgebung.
Bekannte Vertreter:
M 45 oder auch Plejaden (Siebengestirn)
M 20 auch Trifid-Nebel im Schützen
Emissionsnebel (EN) sind ebenfalls Wolken aus interstellarem Staub, welche aber durch heiße, meist junge Sterne in ihrer Umgebung, zum Eigenleuchten angeregt werden.
M 8 oder auch Lagunennebel (siehe Abbildung)
M 42, als Großer Orionnebel bekannt.
Dunkelnebel (DN) sind auch Ansammlungen von interstellarem Staub, die jedoch das Licht der dahinterliegenden Objekte absorbieren. Diese Nebel lassen sich erst beobachten, wenn sie das Licht der Hintergrundsterne oder auch Reflexions- oder Emissionsnebel abdunkeln.
Beispiel:
Barnard 33 vor IC 434, auch als Pferdekopf-Nebel bekannt
NGC 2264, Konusnebel im Einhorn
Planetarische Nebel (PN)
Ihr Name ist leicht irreführend, denn sie haben in keinster Weise etwas mit Planeten zu tun. Sie sind in ihrer Flächenausdehnung recht klein. Beim Planetarischen Nebel handelt es sich um eine oder mehrere Gashüllen, die von einem masseärmeren Stern am Ende seiner Entwicklung, in den Weltraum abgestoßen wurde(n). Der verbleibende Weiße Zwerg regt diese Gashüllen zum Eigenleuchten an. Diese Leuchten dann überwiegend im grünen oder auch blauen Licht (O- III- Linie).
Bekannte Vertreter:
M 27, Hantel- Nebel im Sternbild Fuchs
M 57, Ringnebel in der Leier
M 97, Eulennebel im Großen Bär
NGC 6543, bekannt als Katzenaugennebel im Drache
Supernovae (SN) und deren Überreste (SNR)
Eine Supernova ist das helle Aufleuchten eines Sterns, durch seine Explosion, am Ende seiner Entwicklung. Er wird dabei vollständig vernichtet. Seine Leuchtkraft nimmt dabei um das millionen- ja sogar milliardenfache zu. Er scheint heller als eine Galaxie.
Im Durchschnitt erscheinen solche Super-
novae, für Amateurteleskope, ca. 3 bis 4 mal pro Jahr.
Die verbleibenden Reste dieser Katastrophe, werden dann Supernovaüberrest (SNR) genannt. Bekanntester Vertreter ist M 1 im Stier (siehe Aufnahme), auch Krebsnebel genannt. Diese Nebel werden auch unter Emissionsnebel geführt, da sie, wie bereits weiter oben beschrieben, durch einen oft verbleibenden Pulsar zum Eigenleuchten angeregt werden.
Weitere Supernovaüberreste sind u.a.
NGC 6960, NGC 6974, NGC 6992 (Cirrus- Nebel), NGC 6995, und IC 1340. Sie entstammen alle einer einzigen Supernova. Aufzufinden im Sternbild Schwan.
Auch IC 443, auch als Quallennebel bekannt, im Sternbild Zwillinge, ist ein solcher Überrest.
Zur Beobachtung reichen bereits 60mm Objektivöffnung (am besten mit einem
H-alpha-Filter) und eine dunkle Nacht.
Galaxien (Glx)
Unter Galaxien versteht man in der Astronomie, eigenständige Sternsysteme. Hierbei handelt es sich um große Ansammlungen von Materie, bestehend aus Sternen, Planetensystemen, Gasnebeln, Sternhaufen und Staubwolken. Diese werden alle durch ihre Gravitaion zusammen-
gehalten.
Galaxien werden auch auf Grund ihres Aussehens und Form klassifiziert. Es gibt:
Elliptische Galaxien, Linsenförmige Galaxien, Spiralgalaxien, Balkenspiral-
galaxien und Irreguläre Galaxien.
Die uns nächste Galaxie ist M 31, bekannt als Andromeda-Galaxie. Sie ist nur
ca. 2,3 Millionen Lichtjahre entfernt und kann in einer mondlosen Nacht, bereits
mit bloßem Auge gesehen werden.
Da Galaxien im ganzen Universum verteilt sind, werden sie mit zunehmender Entfernung immer kleiner und somit auch lichtschwächer. Mit guten Amateur-
teleskopen können Galaxien, die noch weiter als 300 Millionen Lichtjahre entfernt sind, gesehen werden.
Schware Löcher
Wird eine Masse derart komprimiert, dass an ihrer Oberfläche die Entweich-
geschwindigkeit infolge der hohen Schwerebeschleunigung gleich der Lichtgeschwindigkeit wird, so kann nichts mehr dieses Objekt verlassen. Auch Licht und jede andere elektromagnetische Strahlung bleibt gefangen. Das Objekt ist somit unsichtbar und wird deshalb als Schwazes Loch bezeichnet.